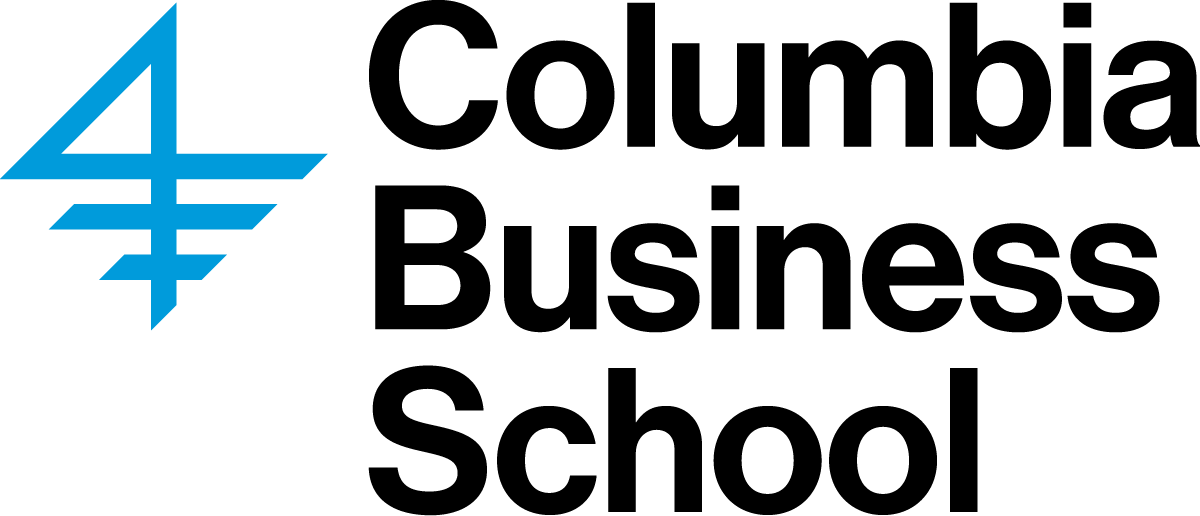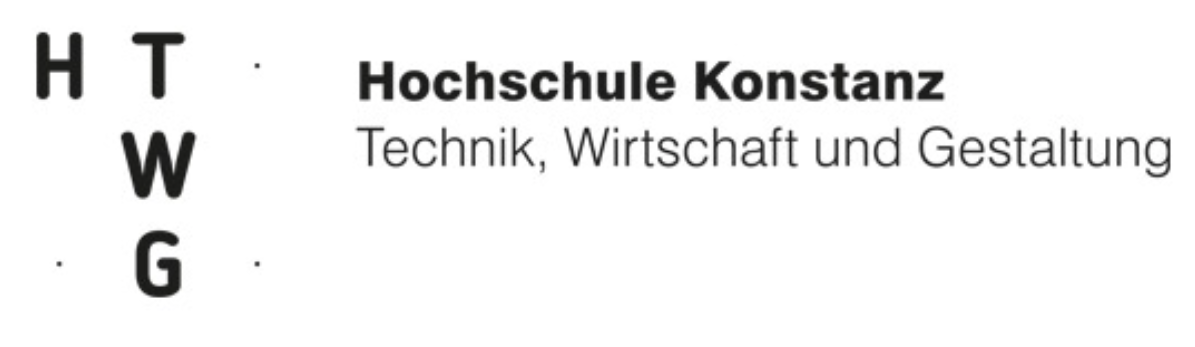Über zwei Jahrzehnte lang galt im Internet ein simples Erfolgsrezept: Inhalte erstellen, die bei Google gut ranken, Klicks generieren, Reichweite monetarisieren. Daraus entstanden ganze Industriezweige: SEO-Agenturen, Content-Farmen und digitale Geschäftsmodelle, die ausschließlich auf Suchmaschinen-Traffic basierten.
Doch dieses Modell bricht gerade zusammen.
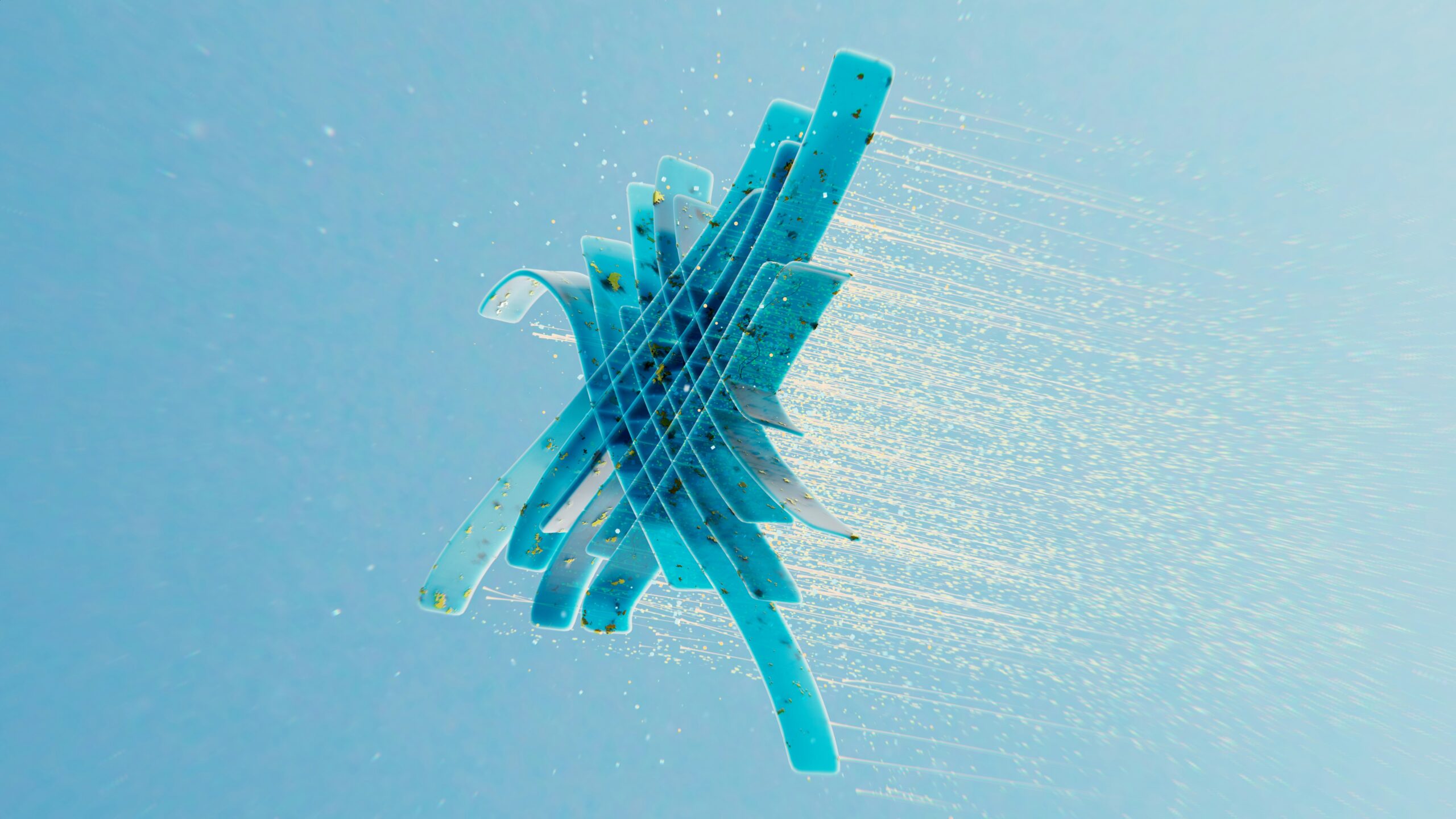
Der Bruch mit dem bisherigen Publishing-Modell
Die bisherigen Mechanismen waren linear aufgebaut: Inhalte wurden auf Reichweite optimiert, Suchmaschinen leiteten Besucher auf die Website, und dort erfolgte die Monetarisierung über Werbung, Affiliate-Links oder Produkte und Services. Das beeinflusste nicht nur Geschäftsmodelle, sondern auch Formate, Inhalte und Zielgrößen. Inhalte wurden zunehmend formelhaft produziert – „10 Tipps für…“, „So funktioniert…“, „Die besten X für Y“ – alles in der Hoffnung, im Longtail der Suchanfragen zu landen.
Die Konsequenz: Informationsüberfluss mit überschaubarer Qualität. Die Suchergebnisse füllten sich mit nahezu identischen Inhalten, deren Mehrwert im direkten Vergleich gering war, aber algorithmisch gut funktionierte.
Warum KI diesen Kreislauf durchbricht
Mit dem Aufstieg generativer KI wie ChatGPT, Perplexity oder Claude hat sich der Zugang zu Information verändert. Nutzer stellen Fragen – die KI antwortet direkt. Ohne weiteren Klick, ohne Weiterleitung zur Originalquelle. Damit wird ein zentrales Element des bisherigen Systems ausgelassen: der Websitebesuch.
Die Folgen sind:
- Einbruch der Reichweite: Laut Similarweb Rückgänge von bis zu 40 % bei Content-Seiten für KI-affine Content-Umfelder.
- Wegfall der Werbeeinnahmen: Ohne Seitenaufrufe fällt auch die Basis für Anzeigenumsätze weg.
- Entwertung von Allgemeinwissen: Informationen, die leicht aggregiert werden können, verlieren massiv an wirtschaftlichem Wert.
Dieser Umbruch betrifft nicht nur Medienhäuser, sondern jede Organisation, deren Inhalte bislang auf Sichtbarkeit durch Suchmaschinen angewiesen waren. Also so gut wie jeder, der Inhalte im Internet veröffentlicht, mit der Hoffnung gefunden zu werden.
Erlösmodelle im KI-Zeitalter
Was tun, wenn Traffic nicht mehr der Schlüssel zur Wertschöpfung ist? Der Fokus verlagert sich von „sichtbar sein“ zu „unverzichtbar sein“ – und mit ihm entstehen neue Wege, wie Inhalte ökonomisch genutzt werden können:
1. Direkte Lizenzierung an KI-Plattformen
Verlage und Organisationen lizenzieren ihre Inhalte direkt an KI-Plattformen – sei es für Trainingszwecke, Zitate oder Echtzeit-Antworten. Die New York Times hat es getan, Springer auch und viele der führenden Qualitätsmedien weltweit. Die Herausforderung liegt in der fairen Vergütung und transparenten Nutzungserfassung. Kleinere Publisher bleiben unberücksichtigt und müssen mehr oder weniger ohnmächtig mit ansehen, wie ihre Inhalte andere erfolgreich machen. Das Machtgefälle ist einfach zu groß, um auf Augenhöhe verhandeln zu können. Ganz abgesehen von der transparenten Messung bei der Verwendung von Inhalten durch KI-Systeme.
2. Strukturierte Datenformate
Inhalte werden nicht mehr für Menschen oder Suchmaschinen geschrieben, sondern maschinenlesbar, strukturiert aufbereitet. Leitlinien, Kennzahlen, Laborstatistiken – wer Inhalte strukturiert bereitstellt, wird für KI-Systeme besonders relevant. KI lebt von strukturierten Daten – denn es gilt das alte Daten-Prinzip: „shit in – shit out“. Fun Fact: Rohdaten werden in manchen Bereichen wertvoller als deren erzählte Aufbereitung.
3. Vergütung bei Zitierung
Ein zukunftsträchtiges Modell wäre die Entlohnung für Quellen, wenn diese von KI-Systemen referenziert werden – ähnlich wie Künstler bei Musikstreaming-Diensten über Royalties. Erste technische Initiativen entstehen, z. B. auf Blockchain-Basis oder durch konsortiale Standards. Perplexity mit seiner Quellentransparenz könnte hier Vorreiter sein. Vermutlich wird es aber ohne regulatorischen Eingriff nur ein „survival of the fittest“ geben.
4. Premium-Inhalte mit menschlicher Tiefe
Was KI (noch) nicht kann: Emotionale Resonanz, originelle Perspektiven, lebendige Diskussionen. Genau darauf setzen neue Formate – sei es im Journalismus, in der Beratung oder im Bildungsbereich. Qualität und Originalität setzt sich durch – ist aber teuer und läuft Gefahr von der KI-Welt in kürzester Zeit ohne adäquate Bezahlung assimiliert zu werden.
5. Zertifizierung und Verifikation
Vertrauen wird zur neuen Währung. Wer geprüfte, belastbare und glaubwürdige Informationen liefert – ob als Medienhaus, Beratungsunternehmen oder Verband– hat noch eine Grundlage für ein Geschäftsmodell.
6. API-basierte Monetarisierung
Erste Organisationen bieten Inhalte über Schnittstellen an – maschinenlesbar, skalierbar und grundsätzlich monetarisierbar. Daten, Analysen oder regulatorische Hinweise lassen sich effizienter integrieren. Die Wissenschaft, Behörden und manche Fachpublikation sitzt hier auf einem Schatz, den sie zum Teil selbst noch nicht ausreichend wertschätzen.
Die neue Informationshierarchie
Die KI-getriebene Ökonomie bringt eine neue Rollenverteilung mit sich:
- Ground-Truth-Anbieter
Forschungseinrichtungen, Behörden, originäre Datenlieferanten – sie stellen die primären Fakten bereit, aus denen relevante Informationen abgeleitet und aufbereitet werden. - Experten / Rechercheure
Qualtiätsmedien, Beratungen, Think Tanks, Akademien – sie schaffen Kontext, Einordnung und strategische Ableitungen auf Basis des Rohwissens und ordnen dieses ein – auch für die KI-Giganten wichtig. - KI-Systeme
Sie aggregieren, verknüpfen und präsentieren Informationen – noch ohne originären Beitrag. - User Interfaces
Die eigentlichen Zugänge – Assistenzsysteme, Dashboards, Plattformen – über sie erfolgt der Zugriff auf Inhalte und Erkenntnisse.
Verlierer in diesem System? Die klassischen Publisher, Aggregatoren oder Blogs ohne originäre Quellen. Ihre Relevanz schwindet. Das Prinzip: „Kill the middle man“. Warum sonst bietet Google im Suchergebnis an erster Stelle bereits die KI-generierte Antwort an? Die Suchmaschine zerstört sich selbst ein bisschen, um eine Überlebenschance zu haben.
Was ist zu tun
Für wissensbasierte Organisationen eröffnen sich neue Chancen:
- Information in Wert umwandeln: Statt Reichweite zählt künftig Relevanz. Wer originäre, belastbare Inhalte bietet, bleibt gefragt. Ein Content-Audit mit anschließender Strategie-Arbeit ist notwendig.
- Daten strategisch strukturieren: Wer seine Informationen KI-kompatibel aufbereitet, wird bevorzugt integriert und bezahlt, wenn er seine Inhalte vor dem Zugriff anderer schützen kann.
- Kooperationen mit KI-Anbietern suchen: Partnerschaften zahlen sich in der noch laufenden Frühphase aus – nicht erst, wenn Standards etabliert sind. Hier haben fachspezifische Publikationen mit eigenen Quellen die besten Chancen im vertikalen Markt.
- Qualität über Quantität: Inhalte mit Substanz – das wird das neue Erfolgsrezept. Nicht mehr vom Gleichen, was heute schon meist bequem über KI generiert wird.
- Eigene Stärken ausspielen: Menschen können, was Maschinen nicht können – Kreativität, Urteilskraft, Vertrauenswürdigkeit.
Die Stunde der Wissensführer
Wir stehen am Anfang einer grundlegenden Umwälzung der digitalen Wissenswelt. Die gute Nachricht: Wer über belastbare Informationen, tiefes Fachwissen oder strategische Einordnungen sein Geschäft macht, wird künftig vermutlich noch wertvoller. Der Weg dorthin erfordert Mut zur Veränderung, technisches Verständnis – und eine klare Positionierung im neuen Informationsökosystem. Zur Wahrheit gehört aber auch: Nicht für jeden Publisher wird dieser Weg gangbar sein.